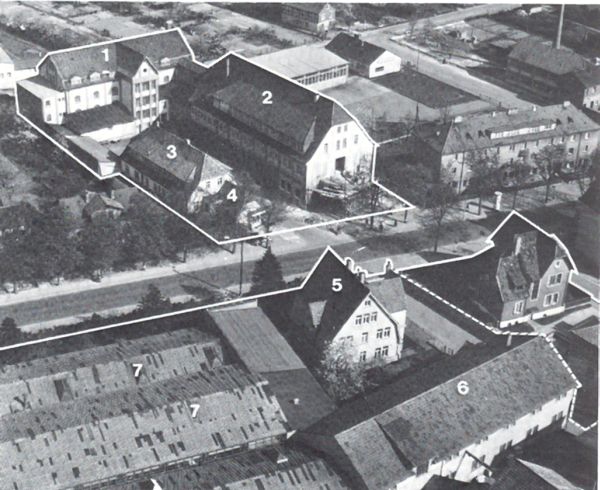|
Nun ja, in ein paar Monaten würde es vorbei sein, dann gingen wir ja wieder nach Hause. Wirklich, so haben wir immer gedacht, besser gesagt, gehofft. Allein, ich wagte es nicht, diese Gedanken in meine Briefe zu schreiben. Stell Dir vor, dass es doch viel länger dauern würde, als wir dachten. Für meine Eltern wäre die Enttäuschung groß gewesen, und das musste ja nun nicht sein. Treu schrieb ich ihnen jede Woche einmal, manchmal sogar zweimal einen Brief von mindestens vier Seiten mit Erlebnissen, die mit dem Krieg als solchem nichts zu tun hatten. Von wo ich den Stoff für solche langen Briefe herholte, begriff ich manchmal selbst nicht. Es war, als ob ich in den Briefen meinen Eltern gegenüber saß und erzählte. Auf diese Art schreibt man jemandem, den man liebt, am Einfachsten. Auf jeden Brief erhielt ich Antwort. Jedes mal war es meine Mutter, die schrieb. Mein Vater war kein großer Schreiber und hatte schließlich auch noch das Geschäft. Ich fand es gut so. Ich habe es meinem Vater nie übel genommen, dass er niemals die Feder zur Hand nahm.
Die Post landete immer beim Pförtner, wo man sie dann erbitten musste. Viele Jungs bekamen nicht nur von ihren Eltern Post. Ein paar Jungs auf meinem Zimmer hatten ein Mädchen oder waren schon verlobt. Verheiratete waren nicht dabei, obwohl wir alle so um einundzwanzig/zweiundzwanzig waren. Auf einmal kam mir die Idee, dass ich auch eine Brieffreundin haben wollte, aber wie sollte ich daran kommen? Ich erinnerte mich an ein Mädchen, das ich ein paar mal bei einem Kunden von v. d. Slikke, wo ich arbeitete, gesehen hatte. Ich wusste nur ihren Nachnamen, aber so weit ich wusste, war sie die einzige Tochter im Hause. Das Mädchen hatte ziemlich Eindruck auf mich gemacht, da sie sehr lieb aussah und mir gegenüber, als Klempner-Elektriker bei v. d. Slikke, freundlich war. Ich fasste mir ein Herz und schrieb ihr einen Brief, in dem ich ihr erklärte, dass ich gerne eine Brieffreundin haben wolle, und ob sie vielleicht Interesse habe, mit mir zu korrespondieren. Ihr Vater hatte eine Gärtnerei, und ich wusste so ungefähr die Adresse, jedenfalls die Straße. Auf gut Glück habe ich damals den Brief verschickt und bekam nach drei Wochen wahrhaftig Antwort von Willie G. [Willie ist ein weiblicher Vorname], die auf meinen Vorschlag einging. Das freute mich. Natürlich unterschieden sich die Inhalte der Briefe an meinen Vater und meine Mutter von denen an sie. Bei Willie konnte ich meine Schwierigkeiten, wenn es welche gab, manchmal loswerden, worauf sie dann auch immer einging. Auch durch ihre Briefe bekam ich viel Unterstützung. Sobald ich wieder zu Hause war, habe ich sie in Den Helder aufgesucht, aber darüber später mehr.
Als ich ungefähr anderthalb Monate an den Bänken arbeitete, erkundigte ich mich sehr vorsichtig bei Bart, ob Ordio nicht auch an den Bänken arbeiten könne. Davor hatte ich Ordio gefragt, ob ihm das gut schien, und er wollte das schon. Es war bei ihm genauso wie bei mir, er begann bei dieser geisttötenden Arbeit zu grübeln. Der Einrichter war damit einverstanden, und Ordio wurde mein Assistent. Und nicht nur mein Assistent für drei Drehbänke, sondern für sechs Bänke. Er sorgte unter anderem für die Materialzufuhr, führte das Material aber auch in die Maschinen. Er war bestimmt zwanzig Jahre älter als ich und bestimmt nicht mein Diener. Er benahm sich allerdings manchmal schon so. Wenn eine Maschine stillstand weil sie kein Material mehr hatte, rannte er an mir vorbei, um als Erster bei der Maschine zu sein. "Ich rabotte, Du nicht", sagte er dann und drückte mich beiseite. Und das alles, weil ich ab und zu warmes Essen aus der Kantine für ihn mitschmuggelte. Dann aß er das schnell in einer stillen Ecke auf, wo niemand ihn sehen konnte. Eigentlich ein erbärmliches Schauspiel, und ab und zu hatte ich damit auch meine Schwierigkeiten. Dann versuchte ich, ihm zu erklären, dass er das nicht für mich zu tun brauche, aber darüber konnte man mit ihm nicht sprechen. Wenn wir dann im Luftschutzkeller saßen, er bei den Russen und ich bei dem Rest, zeigte er mich seinen Landsleuten, und dann lachten sie mir zu. Ich bekam dann eine Art Schutzengelgefühl, was auch immer das für ein Gefühl sein mag, und machte mit dem ab und zu Mitbringen von Essen weiter. Wenn es auch Russen waren, so waren es doch schließlich Leidensgenossen von mir.
Ab und zu setzte ich mich zu den Russen. Das durfte man zwar nicht, aber das machte mir nichts aus. Mein Einrichter sah das zwar, aber der sagte auch nichts darüber.
Ich hatte mittlerweile einen anderen Aufseher bekommen, Heinrich Siebert, auch ein sehr feiner Kerl. Der warnte mich einmal, als ich wieder Essen für Ordio mitbrachte. "Das darf du nicht, Cornelis, sei vorsichtig". Aber er verbot es mir nicht.
Heinrich Siebert war mir gegenüber etwas freier als Bart. Er setzte etwas mehr Vertrauen in mich, und damit meine ich nicht in meine Arbeit. Er wagte es, etwas mehr über die Verhältnisse, in denen wir damals lebten, zu sprechen. Er hatte einen Bauernhof in Nörten-Hardenberg, zehn Kilometer außerhalb von Weende-Göttingen. Ihm wurde einfach ein Pole zugewiesen, der für den Bauernhof sorgen musste, während er in der Fabrik arbeiten musste. Er fand das schrecklich und teilte die Auffassung, das dies im Interesse des "Großdeutschen Reiches" war, überhaupt nicht. Das hatte seine Widerspenstigkeit, die ja schon bei ihm vorhanden war, noch verstärkt. Darüber traute er sich mit mir zu sprechen, aber nicht mit einem Anderen. "Du kannst niemandem vertrauen, Cornelis", sagte er dann. "Aber es wird nicht mehr lange dauern." Genau so ein Optimist wie ich, wie wir alle eigentlich.
 Die Burgruine Plesse bei Göttingen um 1955
Die Burgruine Plesse bei Göttingen um 1955
Der Spätsommer 1943 war sehr schön, und ich nutzte jede freie Stunde, spazieren zu gehen. Der Harz ist schön, und ich als Flachländer fand die Berge, auch wenn sie nicht so hoch waren, sehr schön. Ein Spaziergang zur Ruine Plesse, ungefähr 330 Meter "über dem Meer", aus dem Jahre 1300 stammend, lohnte sich. Im Turm war eine hölzerne Wendeltreppe, und darin kratzte ich meinen Namen zu den vielen anderen Namen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich Jahre später, als freier Mann, mit meiner Frau die Wendeltreppe aufs Neue besteigen sollte und dann allerlei Erinnerungen in mir hoch kommen sollten. Mein Name, den ich in das Holz kerbte, war nach 37 Jahren noch deutlich zu sehen und zu lesen, trotz der Tränen in meinen Augen.
Auf dem höchsten Punkt des Turmes konnte man in alle Richtungen blicken. Vor allem wenn man in die westliche Richtung blickte, konnte man einfach so wegträumen, dass einem davon elend wurde. Nur schnell wieder nach unten, denn so ging es nicht gut.
Entlang des Weges dahin standen Apfelbäume, an die man so heran kam. Einige Äpfel waren schon reif, als ich dort eines Tages vorbeilief. Die Früchte waren für die Krankenhäuser und die Soldaten an der Front bestimmt. Auf jeden Fall nicht für Zwangsarbeiter, von denen ich einer war. Dennoch schmeckten die Äpfel sehr gut.
Kurz außerhalb Göttingens lag das kleine Dorf Weende. Das Dorf, in dem ich am Ende des Krieges ein paar Monate gewohnt habe, aber das ist eine andere Geschichte, die etwas später kommt. In dem Dorf, auch an der Weender Landstrasse, fanden wir den Hauptlieferanten der Zwangsarbeiter und der anderen deportierten Ausländer. Der Lebensmittelhändler hieß Heinrich V. [Bäckermeister], und das war wieder ein guter Deutscher. Bei ihm kauften wir ein und bei ihm bekamen wir manchmal etwas ohne Marken, da er eine große Sympathie für uns Zwangsarbeiter hatte. Er bediente uns genau so freundlich wie die Deutschen und duldete es nicht, wenn sich einer der Deutschen vordrängeln wollte. "Sie haben für uns gearbeitet, und dafür müssen wir ihnen dankbar sein", sagte er ständig. Diese Aussage wurde nicht immer gleichermaßen positiv aufgenommen.
Der übliche Gruß beim Kommen und Gehen war "Heil Hitler". Meiner Meinung nach etwas Erzwungenes, an das sich die Meisten hielten, einfach weil man niemandem vertrauen konnte. Wenn wir reinkamen und der Laden leer war, sagte er manchmal "Drei Liter" und lachte dann. Dass er etwas Besonderes war, erwies sich beim Einzug der Engländer in den letzten Kriegstagen. Darüber später mehr.
Irgendwann entdeckten wir sie, die Tierchen. Wandbären nannten sie die Moffen. Bei uns heißen sie Wandläuse [Wanzen]. Zunächst sahen wir sie an den Barackenwänden, und bei genauerer Untersuchung dann auch in den Strohsäcken. Wirklich sehr lästig, und das ist noch milde ausgedrückt. Unser großartiger Lagerführer, ein Kerl, von dem man nichts hatte, da er nie da war, wurde benachrichtigt und kam, um es sich anzusehen. Das Resultat war, dass unsere Baracke mit einer Art Gas entlaust werden sollte. Gas gab es im Krieg genug, nur benutzten sie das Gas zu anderen Zwecken. Wir mussten mit unserem Kram für ein paar Nächte in die Fabrik umziehen. In einem leeren Raum war eine provisorische Schlafgelegenheit vorbereitet worden. Nach, wie ich glaube, zwei Nächten mussten wir wieder zurück. Sie hatten in den zwei Tagen alle Spalten der Fenster und Türen mit Klebeband abgedichtet und dann Gas hineingesprüht. Als wir wieder zurückkamen, bekamen wir neue Strohsäcke und andere Decken. Einfach unsere alten Decken, nur dann gesäubert und chemisch gereinigt, oder so etwas. Die Tierchen hätten jetzt weg sein müssen, aber sie waren noch da. Es waren nicht mehr so viele und sie liefen etwas weniger schnell, aber sie waren eben noch da. Es stank fürchterlich, und wir haben sofort die Fenster geöffnet. Abends roch man nichts mehr, und nach einer Woche waren die Bären auch verschwunden. Sicherlich ein langsam wirkendes Gift. Dass die Moffen darin einzigartig waren, haben wir nach dem Krieg in vielen Büchern lesen können.
Eines Tages, ich denke es war ein Samstag, kamen ein paar Jungs von Zimmer Eins, eine Belegung der weniger guten Sorte, mit einem Mädchen aus der Stadt zurück. Es war ein niederländisches Mädchen, und in dem Fall kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es nicht von der besten Sorte war. Meiner Meinung nach wurden keine [holländischen] Frauen als Zwangsarbeiter angeworben. In Göttingen habe ich nie davon gehört. Dass die Puppe in der Tat nicht von der besten Sorte war, zeigte sich zwei Tage später. Die ganze Belegung des Zimmers, zwölf Mann also, landete mit einem Tripper, auf Latein Gonorrhöe, im Krankenhaus. Das Mädchen war also nicht ganz astrein. Jungs vom Nebenzimmer haben durch die Ritzen in den Holzwänden sehen können, was sich dort an dem Nachmittag und Abend abgespielt hat. Von draußen war nichts zu sehen, da die Läden fest verschlossen waren. Außerdem gab es dort ein paar Jungs, denen die Faust locker in der Tasche saß, und die sollte man besser in Ruhe lassen.
Dienstags fragte mich Heinrich Siebert, was da bei uns in der Baracke los gewesen war. Er grinste ein bisschen, aber man konnte es seinem Gesicht ansehen, dass er den Ernst der Lage erkannte. "Du warst glücklicherweise nicht dabei, Cornelis. Gib bitte gut auf dich acht." Ende der Woche waren sie alle wieder an der Arbeit; das Mädchen habe ich nie wieder in unserer Baracke gesehen.
In unserer Halle arbeitete auch eine Französin, und das war ein sehr hübsches Mädchen, eine flotte Biene, sozusagen. Wenn die durch die Halle lief, leider geschah das nicht oft, sah ihr jeder gesunde Mann nach. Dann wackelte sie mit ihrem kleinen französischen Arsch, dass es eine Freude war. Sie arbeitete im Büro, in einem Raum in unserer Halle, der eine Etage höher lag als unsere Arbeitsstätte. In dem Büro saß das größte Ekelpaket der ganzen Halle. Passenderweise, oder muss ich unpassenderweise sagen, hieß der Mann Engel. Wenn der in seiner schneeweißen Jacke durch die Halle ging, war jeder an der Arbeit. Dann hörte man nur noch die Maschinen drehen, und niemand unterhielt sich mehr. Ein Mal wurde ich zu ihm zitiert. Ich gab Ordio ab und zu Essen aus der Kantine, und das hatte er gesehen oder es war ihm zugetragen worden. Er erzählte mir, dass das verboten war. Wenn er es noch einmal sehen sollte, würde ich deswegen bestraft werden. Was die Strafe war, sagte er nicht, aber ich konnte es mir ungefähr vorstellen. Ich konnte wieder gehen und sah dann im Vorübergehen im Nebenzimmer die Französin mit ihrem viel zu kurzen Rock sitzen. Sie sah mich an, als ob sie sagen wollte: "Wie wagst du es, mich so anzusehen, ich bin das Liebchen vom Chef."
Wieder mit Händen und Füßen und etwas Russisch-Deutsch, oder war es Deutsch-Russisch, gelang es mir, Ordio zu erklären, warum ich zum großen Chef gehen musste. Heinrich Siebert und Ordio hatten es beide gesehen, dass ich nach oben gehen musste. S. riet mir nochmals, vorsichtig zu sein. "Es wäre schade, wenn dir etwas passiert", sagte er. Zwei Wochen lang musste Ordio mit seiner wässrigen Kohlsuppe auskommen, bis ich entdeckte, dass Engelchen praktisch die ganze Woche nicht da war. Er war irgendetwas bei der S.A. und bekam für die Aktivitäten sicher frei. Die Luft war also wieder rein, und Ordio bekam wieder ungefähr zweimal die Woche seinen warmen Happen von mir. Jetzt hatte er einen noch sichereren Platz gefunden, manchmal sogar auf dem W.C., wo nur die Russen hin durften. S. sagte dazu nichts, er war ein guter Kerl.
Einmal aber bin ich krank gewesen. Na ja, krank. Ich hatte Wasser in den Knien, und das kam vom langen Stehen an den Drehbänken. Irgendwo in Göttingen, ich weiß nicht mehr wo, gab es eine Baracke, in der Ärzte waren. Die waren nur für Zwangsarbeiter da. Der [Arzt] zog mit einer Spritze das Wasser aus meinem Knie, gab mir ein Wundermittel aus einem Medizinbecherchen zu trinken, und ich konnte wieder weggehen. Ich bezweifele, ob das Wundermittel für mein Knie gedacht war, aber ich habe an dem Tag auf jeden Fall blaugemacht. Später, in derselben Woche noch, bekam ich einen Brief, dass ich, ohne mich zu entschuldigen, neun Stunden der Arbeit ferngeblieben bin. Es sollte bei dieser einen Warnung bleiben. Bei einer Wiederholung würde anders aufgetreten werden. "Heil Hitler der Vertrauensrat, Betriebsobmann." Eine schöne Erinnerung an meinen Aufenthalt in Deutschland.
Einer unserer Zimmerkameraden, Rudolf L., hatte ab und zu Kummer. Dann saß er da und starrte vor sich hin und stach dann plötzlich mit voller Kraft ein Messer in den Tisch, wo es dann zitternd stehen blieb. Dann zogen wir uns sofort zurück und ließen ihn sich wieder beruhigen. Später entschuldigte er sich dann und benahm sich wieder normal. Er kam aus Bussum und sein Vater war ein hohes Tier beim Heer, oder so etwas. Manchmal sprach er ein bisschen affektiert und dann benutzte er plötzlich wieder gröbste Ausdrücke. Ein einziges Mal ging ich mit ihm spazieren, und dann führte er hochtrabende Gespräche, deren Nutzen ich nicht einsah. Er sprach dann sehr vornehmes Niederländisch, aber am Ende unseres Aufenthaltes in Deutschland war er der Schmutzigste von uns und das interessierte ihn nicht die Bohne. Wenn unser Aufenthalt noch länger gedauert hätte, wäre er verrückt geworden, glaube ich.
Winter 1943 – 1944
Der Winter '43 - '44 war für unsere Begriffe ein strenger Winter und begann für uns viel zu früh. Der Brennstoff für unseren Ofen wurde knapp, aber da Niederländer sehr einfallsreich sind, fanden wir auch dafür eine Lösung. Zuallererst waren die W.C.-Türen dran demontiert zu werden. Ob die Tür nun offen war oder zu, die Kälte kam ja doch rein. Die W.C.s waren an der Außenseite der Baracke, also konnte man einen ganz normal sitzen sehen; aber was machte das schon aus, wir waren ja unter uns Jungs. Als es nach einer gewissen Zeit keine Türen mehr gab, musste nach anderem brennbaren Material gesucht werden, und das fanden wir in den Latten unter den Strohsäcken. Auf die Dauer waren die Latten bis auf das Nötigste verheizt. Die Baracke wurde auf die Art beinahe unbewohnbar, und wir mussten umziehen. Auf der anderen Seite der Stadt war noch ein Barackenlager, ungefähr eine dreiviertel Stunde von der Fabrik entfernt; für uns also viel ungünstiger. Das Lager hieß Eiswiese. Es war ein größeres Lager mit mehr Baracken, und dort wohnten auch Russinnen. Es gab auch einen viel aktiveren Lagerführer. Er hatte auch ein größeres Maul, das er allerdings schnell wieder verlor, da unseres noch größer waren. Dennoch hatten wir was von dem Mann.
Mitten auf dem Platz stand ein einzelnes Gebäude, in dem die W.C.s und der Waschraum waren. Alles sah besser aus und wurde auch besser gepflegt. Die Damen- und Herrentoiletten waren durch eine dünne, zweieinhalb Meter hohe Wand von einander getrennt. Wenn man sich auf den Pott stellte, konnte man darüber sehen. Nicht, dass ich das ausprobiert hätte, ein anderer hatte das entdeckt. Bei der ersten Feststellung, dass das passierte, stellten die Russinnen sofort eine Wache vor die Tür, wenn nur eine der Damen dort einen Besuch machte. Die Wachtposten waren Bären von Mädchen, mit denen nicht zu spaßen war. Niemandem wäre es eingefallen, dennoch einen Versuch zu wagen, gleichzeitig nach drinnen zu wollen, da man sich dann ordentlich was einfangen konnte. Besser nicht ausprobieren also. Die Regel war durch die Bewohner selbst aufgestellt worden, und jeder hielt sich daran. Unter der Dusche bin ich dort nie gewesen. Bei der Fabrik war eine Duschgelegenheit, die sehr gut war. Von der machte ich Gebrauch. Seltsam, dass all die Ausländer so gut miteinander auskommen konnten. Mit Ausländern meine ich natürlich Nicht-Deutsche. Wir alle formten gleichsam eine Front, als ob wir an nichts anderes gewöhnt waren. War das nicht auch eine Form von Lebenserhaltung, ein Suchen nach Unterstützung bei den eigenen Problemen? Denn dass jeder mal Probleme hatte, war ein Ding, das sicher war.
In einer der Baracken bekam ein Junge Heimweh. Er aß und trank zuletzt gar nichts mehr und lag ganze Tage auf dem Bett. Man konnte kaum noch mit ihm sprechen. Letztendlich durfte er dann doch zurück in die Niederlande, aber da war es schon zu spät. Ein paar Monate später bekamen seine Freunde einen Bericht seiner Eltern darüber, dass er gestorben war.
Die Briefe meiner Eltern und Willie G., obwohl die natürlich weniger oft schrieb, waren eine Stütze für mich. Alle Post von zu Hause wurde immer mit Gejauchze begrüßt. Die Post kam jetzt über die Aluminiumwerke Göttingen zur Eiswiese und wurde dann vom Lagerführer verteilt. Wenn man dann so einen Brief las, war man wieder für kurze Zeit zu Haus; und so einen Brief las man wohl dreimal und warf ihn erst weg, wenn wieder ein neuer Brief da war.
Eines Tages kam der Lagerführer in alle Baracken und bot Kondome zum Kauf an. Dies tat er sicher wegen der Anwesenheit der Russinnen. In meinem Zimmer gab es ein paar Jungs, die mit einem Mädchen aus den Niederlanden eine feste Verbindung hatten. Es gab auch welche, die mit einem Mädchen korrespondierten, so wie ich. Der Händler wurde fluchend aus dem Zimmer gewiesen, und er hat es nie wieder probiert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Russinnen auf uns Niederländer warteten.
Natürlich erkundete ich auch in meiner freien Zeit, die ich ja schon hatte, die Umgebung der Eiswiese. Bei einem dieser Spaziergänge entdeckte ich eine kleine Fabrik, in der, meiner Vorstellung nach, nur Frauen arbeiteten, in der Hauptsache Russinnen. Ich sprach hierüber mit einem der Jungs in der Halle, einem Russen, der dicht bei mir arbeitete und mit dem ich ab und zu ein Schwätzchen hielt. Zwei Tage später kam er mit einem Brief an; ob ich den einem der Mädchen geben wolle, welchem könne ich mir selbst aussuchen. Ob ich das tun wolle? Natürlich wollte ich das. Bei der nächsten Gelegenheit wartete ich am Fabriktor auf die Ankunft der Frauen. Als sie nach draußen kamen, fiel mir eines der Mädchen besonders auf. Sie war nicht unhübsch, sah süß aus, aber auch ein bisschen zart (zumindest wenn das bei Russinnen möglich ist). Ich lief auf sie zu und reichte ihr den Brief von Anatolie. Sie sah mich fragend an und nahm dann den Umschlag. Sie riss ihn auf, las ihn und begann mich danach anzulachen. Wie es einem Menschen gelingt, weiß man manchmal selbst nicht, aber ich konnte ihr deutlich machen, dass ich in einer Woche zurückkommen würde. Sie nickte mir lachend zu und lief dann wieder hinter ihren Freundinnen her. Am nächsten Tag erzählte ich Anatolie, dass ich den Brief abgegeben habe, und er war darüber froh. Am vereinbarten Tag zur vereinbarten Stunde stand ich wieder am Fabrikstor und wartete auf sie. Als sie mich dort stehen sah, kam sie sofort auf mich zu und gab mir einen Briefumschlag. Sie ging sofort weiter, ohne dass ihre Handlung aufgefallen war. Von dem Tage an bin ich lange Zeit eine Art Postillion d’amour zwischen Anatolie und der Russin gewesen. Es wurden sogar Photos ausgetauscht, und ich fühlte, dass ich damit eine gute Tat vollbrachte. Später, als wir befreit waren, habe ich sie getroffen, und sie waren gute Freunde geworden.
In den Baracken gefiel es mir überhaupt nicht. Es gab viel mehr Bewohner, und unsere Gruppe aus der Weenderlandstrasse war wegen des Umzugs auseinandergegangen; und jetzt waren dort einige Jungs dabei, mit denen ich keinen so guten Kontakt hatte. Außerdem musste ich jetzt mindestens eine dreiviertel Stunde zur Fabrik laufen. Tagsüber war das nicht so schlimm, aber in der Nacht war das kein Spaß. Außerdem war dieser Winter nichts, worüber man nach Hause schreiben konnte; es lag sehr viel Schnee und ich musste mit meinen Holzklumpen da hindurch pflügen. Der Schnee blieb besonders gut an den Holzsohlen kleben, so dass ich mir alle paar hundert Meter den Schnee von den Schuhen klopfen musste, wollte ich mir nicht die Fußgelenke verstauchen. Zu allem Unglück wurde ein Teil der Fabrik, gerade der, in dem ich arbeitete, in ein Dorf außerhalb Göttingens verlegt, Weende, was meinen Fußweg noch eine Viertelstunde länger machte. Wir bekamen dort eine Art Trockenscheune zur Verfügung gestellt, und Heinrich Siebert ging glücklicherweise mit uns. Für ihn war das günstig, da er jetzt näher an seinem zu Hause arbeitete. Dank Heinrich Siebert veränderte sich das wieder, aber darüber später mehr.
Natürlich suchte ich auch Entspannung. Den ganzen Tag, wenn man frei hat, in der Baracke zu bleiben, hätte mich krank gemacht. Ab und zu, wenn das Geld es zuließ, gingen wir in die Stadt essen. Eine warme Mahlzeit ohne Fleisch, es schmeckte nur scheußlich und doch war es eigentlich schmackhaft. Viel war es übrigens nicht, eigentlich nur Magenfüllung. Der Gaststätte Schwarzer Bär gab ich den Vorzug. Es war eine sauberes Gasthaus und für unsereins gab es einen extra Saal, in dem wir jedoch anständig bedient wurden. Ich kaufte dort eine Kartoffelkarte für vierzehn Mahlzeiten, pro Marke gut für eine Portion Kartoffeln. So eine Mahlzeit nannte man „Stamm“. Ein einziges Mal konnte man zweimal Stamm kaufen, und da wurden dann beide Male auf der Kartoffelkarte Abstreichungen gemacht. Mehr als zweimal „Stamm“ bekam man nicht, und ich hatte daran genug, aber es gab Jungs, die dann schnell zur zweiten bevorzugten Essgelegenheit gingen, der „Stadtschänke“, und da noch eine Portion „Stamm“ aßen. Ein Beweis, dass dort wie gesagt kein Nährwert drin war.

Göttinger Vergnügungslokal Stadtpark
Es gab auch eine Kneipe hinter dem Rathaus, „Kellers Bierstube“. Ich glaube, das war nahe beim Central Theater. In Kellers Bierstube trank ich mein Bier, oder besser gesagt, lernte ich Biertrinken. Am Anfang trank ich Dunkel, ein sehr süßes und dunkles Bier. Später bekam ich das nicht mehr, da es eigentlich ein Frauenbier war. Dann wurde es „halb und halb“, halb Dunkel, halb Pils. Das schmeckte eigentlich auch ganz gut, aber bitterer als das dunkle Bier. Es gab noch das Kino Capitol-Theater in der Prinzenstrasse. Ein etwas luxuriöseres Theater, aber dieselbe Art von Filmen. Dann gab es noch einen Konzertsaal, „Stadtpark“, in dem ich ein paar Mal gewesen bin. In meinem blauen, aber sauberen Arbeitsanzug saß ich zwischen den, in ihren guten Sachen gekleideten Deutschen; aber das machte mir nichts aus. Es gab noch einen Saal, „Theater der Stadt Göttingen“. Das klingt beeindruckend, aber das Innere des Gebäudes gefiel mir ehrlich gesagt nicht so gut. Da habe ich am 25. Dezember 1943 zum ersten Mal in meinem Leben eine Oper gesehen, und zwar „Carmen“ von George Bizet. Für eine Mark sechzig saß ich im dritten Rang, Stuhl 34 und fand es herrlich. Endlich einmal keine Holzbank unter dem Hintern, sondern sanftes Plüsch ohne Wandbären [= Wanzen - C.T.]. „Der Bajazzo“ und „Cavalleria Rusticana“ habe ich dort auch gesehen.
Wenn ich in die Stadt ging, realisierte ich, warum niemals eine Bombe auf Göttingen geworfen wurde. Industrie gab es wie gesagt nicht, sondern nur sehr viele Krankenhäuser, und diese Krankenhäuser waren übervoll mit verwundeten deutschen Soldaten. Wenn sie mobil waren oder es nach der Behandlung wurden, sah ich sie oft in der Stadt. Mit einem Arm oder ohne Arme, mit einem Bein, zwischen zwei Krücken hängend, die weit auseinander standen, so dass man viel Platz machen musste, wenn man an ihnen vorüberging, oder in einem Rollstuhl. Aber alle in Uniform und mit einem „Eisernen Kreuz“ auf der Brust, mit oder ohne Laub, oder wie das hieß. Was für eine Ehre doch so eine Auszeichnung empfangen zu dürfen, manchmal sogar aus den Händen des größten Massenmörders, den unsere Welt gekannt hat, Adolf Hitler, und die mit Stolz zeigen zu können, mit einem leeren Ärmel, der an die Jacke gesteckt ist, oder in einem Rollstuhl, ein Körper ohne Beine. Sie müssen auf so eine Auszeichnung stolz sein, das erwartet A. H. von seinen Soldaten. Aber waren all die Soldaten in Göttingen das auch, ich bezweifle es. Das Stolze, den unbesiegbare Blick, den ich in ihren Augen sah, als die ersten Truppen in Den Helder einrückten, sah ich nicht in diesen Augen. Wenn man ihnen versehentlich in den Weg lief, bekam man einen Anschnauzer, vielleicht weil sie einem kompletten Menschen begegneten.
Es gab auch Jungs in meiner Gruppe, die vor dem Essen ein Gebet aufsagten. Das Beten hat höchstens eine Woche gedauert. Warum sie es sich versagten, habe ich mich später häufiger gefragt. Es wurde einfach keine Rücksicht auf sie genommen. Wir hielten nicht einmal kurz unseren Mund, sondern quatschten einfach weiter. Oder zweifelten sie selbst an dem Nutzen zu Gott zu beten, jetzt da sie alles um sich herum sahen und was die Menschen daraus selbst gemacht hatten? Ich selbst bin nicht gläubig, obwohl ich schon zu einer damaligen Sonntagsschule gegangen war. Meinen Eltern zufolge gehörte das zu meiner Erziehung. Ich fand es nur lästig. Der Nutzen drang nicht zu mir durch, und ich kam immer zu spät zum Fußball, wenn H. R. C. zu Hause spielte. Am Ende des Schuljahres, wenn ich das so nennen darf, bekam ich eine Art Bibel mit Psalmen und Gesängen, versehen mit dem Namenszug des Hauptes der Sonntagsschule, des Herrn C. Koorn. Ich habe niemals darin gelesen. Und dennoch wollte ich einmal mit ein paar Jungs in eine Kirche in Göttingen. Katholisch, reformiert oder altreformiert [die größten Konfessionen in den Niederlanden, Lutheraner gibt es dort kaum - HEW], ich weiß nicht einmal mehr, was für eine Kirche das war. Eine Kirche ist für mich eine Kirche. Ein Haus, in dem man lernt, wie man mit seinem Mitmenschen umgehen sollte. Wie viel Menschen sind dort schon durch ihr Examen gefallen?
Gut, ich ging also mit, auch um ihnen eine Freude zu machen. Man saß da warm und komfortabel und sie sangen schön. Bis dann der Prediger anfing, zu sprechen. Natürlich sprach er Deutsch, aber das konnte ich gut verstehen. Das hatte ich schon gelernt in den paar Jahren. Aber das so ein Verkündiger von Gottes Wort jetzt auch noch Deutsch sprach, kam mir vor, als ob er fluchte. Es ist dann auch bei diesem einen Besuch in einer Kirche geblieben. Ich fand dort nicht, was ich vielleicht suchte. Eine Antwort auf die Frage, warum ich hier sein musste. Und diese Antwort würde ich bestimmt nicht von so einem Deutsch sprechenden Priester oder Pfarrer, oder was für einen Status der Mann auch immer hatte, bekommen.
Ein doppelter Umzug
Ich musste also mit Johan, einem Zimmergenossen von mir, der ebenfalls aus Den Helder stammte, und unseren Maschinen nach Weende umziehen. Den Grund dafür hat man mir natürlich nie mitgeteilt. Glücklicherweise ging Heinrich Siebert auch mit zu der Ex-Trockenscheune; ich war darüber froh, denn er war ein guter Kerl. Ich habe vier- oder fünfmal einen Tag lang bei ihm auf dem Bauernhof in Nörten-Hardenberg gearbeitet. Mein Verdienst war eine erstklassige Mahlzeit und ein großer Sack große Bohnen, Gartenbohnen hießen die Dinger bei uns, zumindest verglich ich diese Bohnen damals damit. Es war dort fast Schweinefutter, doch mir schmeckten sie sehr gut. Ich rauchte damals auch noch nicht, bekam aber Zigaretten, ungefähr drei Päckchen pro Monat. „Rama“ hieß die Zigarette. Wie die Zigarette schmeckt, weiß ich nicht. „Rama“ war ein hervorragendes Tauschobjekt, vor allem bei den Deutschen. Die waren offensichtlich auch auf Ration. Ich bekam für ein Päckchen Rama fünf Pfund große Bohnen, manchmal sogar ein ganzes Brot von tausend Gramm. Wie gut, dass ich damals nicht rauchte.
Ich arbeitete kaum einen Monat in Weende in der Scheune, und hatte mittlerweile schon lange die Nase voll von dem ganzen Hin- und Herlaufen von Weende zur Eiswiese, als Siebert Johan und mich fragte, was wir davon hielten, möbliert bei einer Witwe zu wohnen. Sie wohnte keine Viertelstunde Fußweg von unserer Arbeitsstelle entfernt. Johan und ich hielten da sofort sehr viel davon. Ob wir nicht erst bei dieser Frau Melchior auf Besuch gehen wollten, den Rest in der Fabrik würde er schon für uns regeln. Wir besuchten sie noch am selben Tag und das Kennenlernen verlief für beide Seiten sehr günstig. Für sie war das Risiko, zwei Ausländer ins Haus zu nehmen, natürlich größer als der Umzug für uns war. Wir konnten uns natürlich nur verbessern. Es war ein Zimmer mit zwei nebeneinander stehenden Betten, einem Schrank, einem Tisch und zwei Stühlen. Das Zimmer hatte zwei Fenster, die auf den Steinweg hinaussahen [Steinweg 65 – Göttinger Adressbuch 1937] und war im Erdgeschoss. Ihr Schlafzimmer grenzte an das unsere, und sie hatte auch noch eine große Küche, in der sie tagsüber und abends saß. Dort stand ein großer Tisch und vier einzelne Stühle und eine Bank an der Seite. Ein großer Herd, der mit Holz befeuert wurde, sorgte für die Wärme, und sie kochte auch darauf.
Einige Tage später zogen Johan und ich bei ihr ein, und es schien, als ob wir im Paradies gelandet wären. Das zwar etwas übertrieben, aber doch gut zu verstehen. Von einer Holzbaracke mit nichts auf dem Boden jetzt zu geputztem Linoleum und sogar Teppichen hier und da. Zu zweit im Zimmer statt zu zwölft. Nicht auf einem Strohsack, sondern auf einem angenehm weichen Untergrund. Und dann die Decken; eine Bettdecke mit Daunen gefüllt – das fand ich so angenehm warm. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich unter einer Daunendecke schlief. Später, viel später sind meine Frau und ich auch dazu übergegangen [Daunenbetten sind in den Niederlanden sehr unüblich - HEW]. Und sauber, sauber!
Frau Melchior war eine Witwe von ungefähr sechzig Jahren. Ihr Mann war schon vor dem Krieg gestorben, und jetzt wollte sie, vor allem in dieser angespannten Zeit, Menschen um sich haben. Siebert kannte sie gut und hatte ein gutes Wort für uns eingelegt und ihr erzählt, was für Jungs Johan und ich waren. Viel später erzählte sie uns, dass sie noch eine Tochter hatte, die mit den Verwundetentransporten im Zug fuhr. Von der Front ins Hinterland. Wir haben die Tochter nie getroffen. Kurz bevor der Krieg vorbei war, ein paar Tage bevor wir durch die Alliierten befreit wurden, war sie eines Nachts mit einem Arzt, der auch in diesen Zügen fuhr, bei ihrer Mutter zu Hause gewesen. Am nächsten Tag erzählte mir Frau Melchior von dem Besuch. Sie war vollkommen durchgedreht. Der Arzt hatte ihr von der Existenz der Konzentrationslager erzählt. Sie wusste von der Existenz dieser Lager wirklich nichts. Obwohl wir doch viel näher an der Quelle saßen, hatte wir davon auch nichts gemerkt. „Mein armes Deutschland, was bist Du tief gesunken“, sagte sie ein paar Mal; und sie weinte in meiner Gegenwart.
Sie war meiner festen Überzeugung nach keine Nationalsozialistin, sondern liebte ihr Land. Sie war plötzlich noch freundlicher zu uns als sie ohnehin schon war. Es schien, als wolle sie uns gegenüber etwas wieder gut machen und dafür gab es nun doch wirklich keinen Grund. Wir hatten es bei ihr sehr gut. Wir lieferten bei ihr unsere Marken für Kartoffeln, Kaffeesurrogat, Margarine, Nährmittel und Fleisch ab. Marken für Brot, Butter für das Brot u.s.w. behielten wir selbst, da wir bei ihr nur warm aßen, und wir mussten Kostgeld bezahlen. Wie viel, weiß ich nicht mehr, aber viel war es nicht. Sie machte es mehr aus Geselligkeit, da sie sonst manchmal Angst hatte. Sie war sehr sauber. Unsere Betten wurden jede Woche gewechselt, und ich schlief unter einer dicken Decke, auch wenn es nicht kalt war. Die Dinger waren herrlich warm, manchmal sogar zu warm. Es war ein Genuss, in all der Reinheit zu wohnen, nach all den Monaten in einer Baracke auf einem Strohsack und mit zwölf Mann in einem Zimmer.
Frau Melchior besaß ein Stück Wald, das an das Dorf grenzte. Den Wald musste sie selbst in gutem Zustand erhalten. Das konnte sie natürlich nicht allein. Ein Freund ihres verstorbenen Mannes machte das. Auf die Anweisung eines Försters hin musste sie dann eine gewisse Anzahl Bäume fällen und die Bäume auch wieder wegräumen. Bevor der Winter '44 –'45 einfiel, musste das Holz gefällt werden. Sie fragte Johan und mich, ob wir dem Mann helfen wollten, und natürlich wollten wir das. Wir fuhren mit einem Traktor mit langem Anhänger in den Wald, wo die Bäume bereits gefällt waren; dort mussten wir beim Laden helfen. Hinten in ihrem Garten wurde alles abgelegt, und dann war es unsere Aufgabe, all die Bäume auf ein handliches Format zu kürzen, so dass die Stücke in den Ofen in ihrer Küche passten. Mit einer Bügelsäge sägten wir die Stämme auf eine bestimmte Länge und die Stücke schlugen wir dann wiederum mit einem schweren Beil entzwei. Ich denke, dass wir damit eine Woche beschäftigt gewesen sind. Aber dann war ihr extra für den Zweck bestimmter kleiner Schuppen auch brechendvoll. Ausreichend für einen langen strengen Winter. Für diese Hilfe war sie uns sehr dankbar. Ich habe es gerne für sie getan, denn sie war zuletzt wie eine zweite Mutter für mich. Nun ja beinahe, denn es geht nichts über die eigene Mutter, und das merkt man erst, wenn sie nicht da ist. Ich unterhielt mich oft mit ihr in ihrer warmen Küche. Johan war oft in der Stadt auf einen Kneipenbummel, aber er kam niemals betrunken nach Haus. Er hat es fertiggebracht, ungefähr eine dreiviertel Stunde mit einem Bierchen herumzusitzen, und wenn der Ober dann zu deutlich darauf drängte, dass er noch etwas trinken solle, zahlte er und ging irgendwo anders hin. Ich war kein starker Biertrinker. Die Spatzen mussten schon keuchend vor Hitze auf dem Dach sitzen, wenn ich mehr als ein Bier trinken wollte.
Die Erlösung naht
Der sechste Juni 1944 war für alle Zwangsarbeiter, und natürlich nicht nur für uns, ein Tag, den man nie wieder vergisst: die Invasion in der Normandie. Am siebten Juni las ich auf einem kleinen Plakat, dass die Alliierten irgendwo an der Küste Frankreichs gelandet waren. Das Papier war höchstens vierzig mal fünfzig Zentimeter groß, aber es war der wichtigste Bericht des Krieges. Amerikanische und Englische Truppen, aufgestockt mit Freien Franzosen, waren an der Küste der Normandie gelandet und hatten damit den Atlantikwall durchbrochen. Bei uns allen herrschte eine Hurrastimmung. Jetzt würde es nicht mehr so lange dauern und wir würden nach Hause gehen. Glücklicherweise wussten wir damals noch nicht, dass es noch fast ein Jahr dauern würde, bevor wir wieder zu Hause waren. Von dem Moment an, also seit der Invasion, waren die Kriegsnachrichten immer, dass die Deutschen sich nach Plan zurückgezogen hatten, aber den Angreifern schwere Verluste zugefügt hatten. Wie schrecklich das war, haben wir nach dem Krieg in vielen Büchern lesen können. Ich begann, immer öfter zwischen den Zeilen zu lesen und kam zu dem Schluss, dass es gut, aber sehr langsam ging; viel zu langsam nach unserem Geschmack.
Die Weltnachrichten im Kino betrafen jetzt nur noch den Kriegszustand an der Front. Die deutschen Truppen wurden wegen ihres Mutes und ihrer Standhaftigkeit, Deutschland verteidigen zu wollen, in den Himmel gelobt; und bestimmt einmal in der Woche sah man den Kopf von Adolf Hitler auf dem Schirm. Wie seltsam, dass die Menschen es einfach so schluckten, was der Mann behauptete. Oder wagten sie es nicht, ihm zu widersprechen und seine Behauptungen in Zweifel zu ziehen? Viele Gelehrte haben nach dem Krieg ihre Meinung darüber publiziert, aber niemand konnte es letztlich begreifen. Seit dieser Zeit kann ich Menschen nicht ausstehen, die mit hoher Stimme vor einer Menge sprechen, egal zu welchem Zweck. Dann höre ich immer wieder seine verhasste Stimme aus dem Kino.
Natürlich plauderte ich ab und zu mit den Mädchen. Die kleinste und molligste hieß Paula Smitats (so spricht man das aus, aber man schreibt es zweifellos anders). Paula war ein freundliches und süßes Mädchen; ein bisschen dumm, aber das machte sie durch ihr Auftreten wieder gut. Wir kamen gut miteinander aus. Sie wohnte irgendwo in einem kleinen Dorf außerhalb Weendes, dessen Namen ich vergessen habe. Es gab dort drei Bauernhöfe und auf einem der Bauernhöfe wohnte Paula mit ihrem Vater und ihrer Mutter und noch ein paar Familienangehörigen, deren Verhältnis untereinander ich nie begriffen habe. Am Zweiten Weihnachtstag war ich bei ihr zu Hause eingeladen; vom Steinweg aus war es ein Fußweg von einer dreiviertel Stunde. Ich wurde von der Familie freundlich empfangen und zu Kaffee mit Torte und einer warmen Mahlzeit eingeladen. Die Gespräche flossen nicht sehr gut. Sie hielten sich ein wenig zurück und wagten kaum etwas zu sagen. Letzteres war den Deutschen in jenen Jahren eigen. Niemand traute sich, seine Meinung zu vertreten, denn man konnte weder dem direkten Nachbarn noch der Familie vertrauen.
Nach dem Abwasch fragte Paula mich, ob ich den Weihnachtsbaum sehen wolle, der in der guten Stube stand. Das, was Paula wahrscheinlich erwartete, vielleicht gehofft hatte, passierte nicht; ich rührte sie nicht an. Warum nicht, habe ich mich selbst später gefragt. Sie war ein liebes Mädchen, und wir kamen gut miteinander aus. Sonst wussten wir wenig von einander, da wir nie die Gelegenheit gehabt hatten, einander besser kennen zu lernen. Vielleicht war der Grund, dass meine Mutter in ihren Briefen schrieb, dass ich bitte nicht mit einer Deutschen oder einem Mädchen aus welchem Land auch immer nach Hause kommen sollte. Das hatte ich auch überhaupt nicht vor, und darum verhielt ich mich in dem Moment etwas zurückhaltend. Irgendwann gingen wir wieder zu der Gesellschaft zurück, wo mir noch etwas zu trinken angeboten wurde. Eine halbe Stunde später nahmen wir Abschied von einander, nachdem wir die Verabredung getroffen hatten, am nächsten Tag ins Kino zu gehen, was Paula auch wollte. Das war nicht der nächste Tag, sondern der Tag vor Silvester, an dem wir dorthin wollten. Am Tag nach meinem Besuch und den Rest der Woche kam sie nicht zur Arbeit. Sie hielt sich auch nicht an unsere Verabredung und ließ mich schön vor dem Eingang des Kinos warten, bis ich schwarz wurde. Kurz nach Neujahr bin ich zu dem Bauernhof gegangen, aber ich fand dort alles verlassen vor, sogar die Möbel waren verschwunden. Was da los gewesen ist, habe nie herausfinden können. Das war also die Episode Paula.
Wie das andere Mädchen hieß, weiß ich nicht mehr. Sie war viel intelligenter als Paula. Sie konnte sogar hochtrabende Gespräche führen, denen ich dann nicht mehr folgen konnte. Dann ging sie auf etwas so tief ein, dass ich sie mit meinen Deutschkenntnissen nicht verstand, aber das machte mir nichts aus. Sie war ein hübsches Mädchen, nach dem zu gucken und sie reden zu hören angenehm war. Sie war auf einem Konservatorium gewesen, und ich vermute, dass sie Geige studiert hat. Warum sie jetzt an dieser Zapfmaschine saß, war mir ein Rätsel. Sie arbeitete mit deutlichem Widerwillen und sehr langsam. Heinrich Siebert fand alles bestens. Man kann fast behaupten, dass er, sicherlich als Deutscher nahezu Sabotage ausführte. Nicht, dass er den Kram vernichtete, aber er setzte sich für die Sache so total nicht ein, ganz anders als Hitler es von seinen Kameraden verlangte.
Ich konnte bereits deutlich merken, dass es mit der deutschen Kriegsmaschine nicht gut ging. Ich bemerkte es am Material. Die sechskantigen Aluminiumstäbe waren nicht mehr gerade und konnten manchmal nicht einmal benutzt werden. Das Öl wurde stets wässriger und kühlte nicht mehr gut, so dass die Bohrer und Meißel verbrannten und immer aufs Neue geschliffen werden mussten. Demzufolge standen die Bänke immer öfter still, und die Produktion sank um bestimmt vierzig bis fünfzig Prozent. Dadurch schien es, als ob auch die Stunden langsamer vergingen und die Befreiung immer wieder verschoben wurde. In den Kinos wurden andauernd wieder sich zurückziehende Armeen gezeigt, aber alles immer planmäßig. Und die meisten Menschen glaubten das immer noch. Sie hatten immer noch die Überzeugung, dass alles gut gehe. Die deutsche Armee war ja unbesiegbar, dem Idioten in Berchtesgaden zufolge. Man hielt es nicht für möglich. Wir konnten uns, sofern das möglich war, noch ein bisschen auf den Krieg orientieren und sahen, wie die Alliierten immer weiter in Europa vordrangen. Aber das ging so langsam und das dauerte so schrecklich lang.
Der Flugverkehr über Göttingen wurde auch intensiver. Die Alliierten flogen jetzt auch tagsüber; wir konnten sie manchmal sogar in der Luft sehen. Kassel, eine sehr große Stadt, die offensichtlich Industrie hatte, wurde schon bombardiert; und das konnten wir tagsüber und nachts deutlich sehen. Tagsüber sah man die Wölkchen in der Luft und nachts sahen wir die Lichtbündel über den Himmel streifen, die die Suchlichter darauf warfen. Kassel war ungefähr vierzig Kilometer von uns entfernt, also konnten wir ruhig danach sehen. Sie saßen in der Fabrik auch immer öfter und länger im Luftschutzkeller. In Weende gab es nur einen Schutzkeller, in den, meiner Meinung nach, nur Würdenträger durften. Wenn nachts geflogen wurde, erklang in der Luft ein monotones Geräusch von Flugzeugen, die auf dem Wege nach Berlin waren, denn das war ihr Ziel, wenn sie über Göttingen gingen. Eine Zeit später kamen sie wieder zurück und flogen dann, befreit von der Bombenlast, viel höher, so dass sie für das Abwehrgeschütz von Kassel nahezu unerreichbar waren. Johan und ich standen dann im Dunkel der Nacht und sahen in den Himmel. Weende gehörte gerade noch zum Kerngebiet von Göttingen; und da wurde wegen des Vorhandenseins all der Krankenhäuser nicht bombardiert. Die Aluminiumwerke waren ursprünglich ein englischer Betrieb gewesen – da fiel also sicherlich keine Bombe drauf. Ein paar Wochen, nachdem wir von den Engländern befreit worden waren und die Amerikaner Göttingen besetzt hatten [es war umgekehrt – C.T.], rollten die Töpfe und Pfannen aus Aluminium schon wieder aus den Toren.
Die Front rückte immer näher, wir konnten das Kanonengedonner schon gut hören, und damit stieg die Spannung. Der nächtliche Besuch der Tochter von Frau Melchior fand statt. Die Verwundetenzüge kamen durch das Näherrücken der Front natürlich auch immer näher in die Gegend.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt fuhr ein Lautsprecherwagen durch Göttingen und Weende, der mitteilte, dass die englischen Truppen an der Grenze Göttingens lägen und dass, nach gegenseitiger Beratung, Göttingen zu einer offenen Stadt erklärt worden sei. Es wurde also nicht nur nicht auf einander geschossen, sondern auch noch mit einander gesprochen. Es würden ein paar Autos der Engländer durch die Stadt fahren, und wenn während der Fahrt auch nur ein Schuss gelöst würde, natürlich von den Deutschen, würde Göttingen bombardiert werden. Glücklicherweise geschah nichts, und die Alliierten konnten Göttingen und Weende ungehindert passieren. Diese Tatsache lässt sich so leicht aufschreiben, aber bedeutet so sehr viel. Wäre doch geschossen worden und wäre also doch bombardiert worden, dann wäre die Chance groß gewesen, dass ich dieses Buch niemals hätte schreiben können. Man kann es sich fast nicht vorstellen.
Um ungefähr sechs Uhr fuhren die ersten Autos durch die Weender Landstrasse; nachdem wir einen ganzen Tag in Spannung gelebt hatten. Erst Jeeps, dann Lastwagen und dann Panzerwagen. Wagen mit Soldaten, eine Truppenverlegung, die kein Ende hatte. Das hat die ganze Nacht gedauert. Gelassen und sich fügend standen die Deutschen am Wegesrand und sahen zu. Ein paar deutsche Mädchen bekamen Schokolade und Zigaretten zugeworfen, was sie nur allzu gerne annahmen. Die Zigaretten waren viel besser, und Schokolade hatten sie seit Jahren nicht mehr geschmeckt. Johan und ich sind natürlich auch zuschauen gegangen und wir fühlten uns befreit. Natürlich sahen wir die Truppen auf eine andere Art an als die Deutschen. Jetzt würde es schnell vorbei sein und wir würden wieder nach Hause gehen, dachten wir damals. Aber wir mussten für unseren Geschmack wieder viel zu lange warten.
Als die Alliierten an der Grenze Göttingens lagen und die paar Soldaten, die in Göttingen lagen, abgezogen waren, waren wir natürlich ohne militärische Bewachung. Es waren ebenfalls etwa hundert SS-ler abgezogen [In Weende befand sich eine SS-Kavallerieschule, die ein Außenlager des KZ's Buchenwald unterhielt C.T.]. Wir waren für eine Nacht und einen Tag frei zu gehen und zu stehen, wo wir wollten; und als ob wir es abgesprochen hätten, gingen alle Nicht-Deutschen zum Eisenbahngelände auf Inspektion. Wir wussten, dass dort ein Güterzug stand, dessen Inhalt, uns zumindest, unbekannt war. Einen Güterwaggon aufzubrechen war kein Kunststück und bald schwirrten wir wie Bienen um die Wabe über das Gelände. In einem Waggon war Schnaps und da standen ungefähr zehn Russen und besoffen sich. Anatolie war auch dabei und der winkte mir ausgelassen zu. Johan und ich fanden einen Waggon mit Zuckerkisten. Da so eine Kiste viel zu schwer für uns zwei war, ließen wir etwas auslaufen. Unterwegs zum Steinweg ließen wir noch etwas auslaufen, einfach auf einem Stückchen Land, und kamen mit Zucker für mindestens ein Jahr nach Hause. Sie [Frau Melchior – C.T.] war sehr froh darüber. Wir gingen sofort wieder zurück zum Eisenbahngelände um nachzusehen, ob dort noch mehr für uns zu holen war. Das meiste war allerdings schon weg. Ein paar Russen waren sternhagelvoll und schliefen einfach irgendwo auf dem Gelände. Wir fanden zwei platte Pappkartons, die einfach zu befördern waren. Was darin war, konnten wir im Dunkeln nicht lesen. Bei Frau Melchior zu Haus entdeckten wir, dass wir Kochkäse mitgenommen hatten. Auch darüber war sie froh. Es schien eine Delikatesse zu sein. Ich habe ein bisschen davon probiert, aber war nicht begeistert davon. Es war ein weicher, fast schmierbarer bleichgelber Käse. Für mich ist es beim Probieren geblieben.
Es gab für uns noch mehr abzustauben. In Weende gab es irgendwo einen Weinkeller, über dessen Existenz einige von uns Bescheid wussten. Also mit alle Mann zum Weinkeller. Man lief einfach dem Schnapsgeruch nach. Die Flaschen lagen draußen gestapelt, und mit ein paar Flaschen unter dem Arm ging man nach unten in den Keller, wo die Fässer lagen. Wenn der Pfropfen nicht herausging, schlug man einfach mit einem schweren Gegenstand ein Loch in den Fassboden und hielt dann die Flasche unter den Strahl Wein. Wir alle wateten in dem Keller durch den Wein. Johan und ich kamen mit zwölf Flaschen Wein zurück zu Frau Melchior. Kümmel nannte sie das und es war ihr alkoholisches Lieblingsgetränk. Ich hab ein ziemlich großes Glas probiert und lag abends im Bett und alles drehte sich. Später habe ich gelernt, dass es eine Art Likör war, und ich hatte es wie Wein aus einer Tasse getrunken.
Am nächsten Tag waren wir immer noch ohne Besetzung, und dann kam mir die Idee, mit dem Fahrrad zurück in die Niederlande zu fahren. Das Beförderungsmittel schlechthin, vor allem für einen Niederländer. Es musste also ein Fahrrad organisiert werden. Ich wusste, wo die SS-Kaserne war und bin dann als es dunkel war dorthin gegangen. In einem der Keller fand ich tastend ein meiner Meinung nach noch vernünftiges Fahrrad. Am nächsten Tag sah ich natürlich, was ich für ein Fahrrad mitgenommen hatte. Beide Reifen platt und verschlissen. Auf dem Sattel konnte man nicht mehr sitzen und die Kette war schwer verrostet. Also ein wertloses Ding. Die Fahrradtour, auf die ich mich schon ein bisschen gefreut hatte, klappte also nicht. Tagsüber bin ich in die Stadt gegangen und sah dort einen Lastwagen voll mit ausgelassenen Russen herumfahren. Ich sah Russen in der Stadt, die beide Unterarme voller Armbanduhren hatten. Die waren alle stehengeblieben und nicht eine zeigte die richtige Zeit an, da sie nicht wussten, wie das ging. Ich sah Anatolie mit seiner Freundin, aber sie sahen mich nicht, da sie zu beschäftigt waren.
Am nächsten Tag war es mit der Handlungsfreiheit wieder vorbei. Die Amerikaner kamen nach Göttingen und bildeten die Besatzungsarmee. Alles begann wieder ein wenig normaler zu funktionieren. An der Weender Landstrasse, ungefähr auf Höhe der Dorfgrenze, wurde ein militärischer Kontrollposten errichtet, an dem sich jeder Passant gegenüber den Amerikanern ausweisen musste. Frau Melchior hatte uns aus ein paar Stückchen Stoff eine niederländische Trikolore auf den Mantel genäht; und das tat Wunder bei dem Kontrollposten. Wir konnten jedes Mal ohne Schwierigkeiten passieren.
Nach einem Tag oder so bekamen wir den Auftrag, uns in der Jugendherberge zu sammeln, einer Jugendherberge, in der vorher die Hitlerjugend gesessen hat, was an den Bildern an der Wand noch deutlich zu erkennen war, die aber innerhalb von fünf Minuten verschwunden waren und im Garten hinter dem Gebäude verbrannt wurden. [Gegenüber dem über Göttingen im Wald gelegenen Gasthaus Rohns, offizielle Adresse Herzberger Landstraße 108, hatte die HJ ein Wehrertüchtigungslager eingerichtet, das nach dem Krieg als Sammelunterkunft für die ehemaligen holländischen Zwangsarbeiter genutzt wurde; es handelte sich nicht um eine Jugendherberge im heutigen Sinne - C.T.] Ich war wieder mit einer Anzahl Jungs auf einem Zimmer, Jungs, die ich noch aus meiner Barackenzeit kannte. Aber das störte jetzt nicht mehr, dass wir mit so vielen in einem Zimmer waren. Wir würden jetzt schnell nach Hause dürfen.
Wir bekamen dort das Essen von den Amerikanern. Dieses schneeweiße dänische Weißbrot, das im Vergleich mit dem sauren deutschen Brot wie Gebäck schmeckte. Mittags gegen halb eins kam die Armeegarküche mit warmem Essen, das vortrefflich schmeckte und vor allem viel Fleisch enthielt, auf den Hof der Herberge. Dann ging man mit dem Essgeschirr nach unten, wo sie einem dann einen Berg Essen drauf knallten, der sich sehen lassen konnte.
Die Herberge grenzte an einen Wald und ein paar Wiesen, auf denen man sich herrlich sonnen konnte, denn wir hatten in der Zeit, da wir auf den Transport warteten, glänzendes Wetter. Als ich wieder in die Niederlande kam, war ich so braun, dass ich aussah wie ein Halbblut. Wir sonnten uns allerdings vorsichtig, denn wir wollten da in der Höhe nicht verbrennen.
Die Belegung unseres Zimmers war jetzt ein buntes Gemisch von Jungs in allen Altersstufen. Es waren sogar ein paar Verheiratete dabei. Ich glaube, dass die von einer Razzia stammten. Das Einvernehmen war untereinander sehr anständig; wir hatten alle die Hoffnung, wieder schnell nach Hause zu können. Aber darauf mussten wir noch lange warten. Es war ja noch immer Krieg.
Zweimal habe ich noch Frau Melchior besucht. Aber nie sehr lange. Stell Dir vor, dass wir gerade an der Reihe gewesen wären repatriiert zu werden und ich wäre nicht da gewesen.
Bei uns auf dem Zimmer war ein Junge, der mit Messer und Gabel aß, und das war in der ganzen Schlamperei natürlich ein merkwürdiges Bild. Lange hat das auch nicht angehalten. Er sprach auch sehr kultiviert Niederländisch und benahm sich vorbildlich. Aber auch das dauerte nicht lange. Es sah aus, als sei er plötzlich unter den Flügeln der Eltern entfleucht und käme mit der Freiheit nicht zurecht. Das Resultat war, dass er für ein paar Tage mit einem Tripper im Krankenhaus landete. Es gab noch einen Jungen, ein sehr kultivierter Bursche. Nachdem er eine Woche bei uns gewesen war, kam er plötzlich mit der Mitteilung an, dass er wegginge. Er hatte eine Stellung als Übersetzer bei der amerikanischen Armee bekommen. Für meine Ohren sprach er auch sehr gut Französisch, Deutsch und Englisch. Manchmal gab er davon eine nicht störende Demonstration. Wir haben ihn später noch einmal in einem ordentlichen Anzug gesehen.
Es gab auch noch einen Mann, der verheiratet war, es aber mit der Treue nicht so genau nahm. Jeden Abend verschwand er nach dem Essen und kam erst spät zurück. Dann zog er ein schneeweißes Oberhemd an, das niemand sonst besaß, eine Hose mit ordentlicher Bügelfalte und schöne echte geputzte Schuhe. Keine Holzschuhe, wie ich sie trug. Vater geht noch mal los, so war es. Wir sagten dazu manchmal etwas und dann wurde er stinksauer. Einmal haben wir ihn zu packen bekommen. Er hatte seine Ausgehsachen schon an, musste aber noch kurz auf das W.C. Wir haben dann eine Kanne voll mit Wasser auf die angelehnte Tür gestellt und dann auf ihn gewartet. Nach fünf Minuten kam er zurück, stieß die Tür auf und bekam die volle Ladung ab. Ich habe noch niemals jemanden so böse gesehen. Er schlug mit der Emaille-Kaffeekanne so hart auf den Tisch, dass der Henkel abbrach und die Emaille nur so herumspritzte. Eine halbe Stunde später ging er doch noch weg. Er hatte mit einem Bügeleisen das Hemd doch noch wieder vorzeigbar gemacht. Nach diesem Tag haben wir nie wieder etwas zu ihm gesagt.
Einer der Bewohner der Eiswiese bekam vier Tage frei, um in den Niederlanden zu heiraten. Allerdings mussten zwei Jungs für ihn bürgen. Wenn er nicht zurück käme, würden sie verhaftet werden, und was das bedeutete, wussten wir so ungefähr. Zehn Minuten bevor der Termin verstrichen war, spazierte er mir nichts dir nichts in das Barackenzimmer und sagte: „So, da bin ich wieder“. Was haben die zwei Jungs für eine Angst gehabt. Dieser Junge war nun auch bei mir auf dem Zimmer in der ehemaligen Erziehungsanstalt der Hitlerjugend. Er war ebenfalls kein treuer Ehemann, denn er lag in aller Gemütsruhe mit einem Mädchen im Bett, während wir dabei saßen. Exkollegen dieses Jungen hatten übrigens dessen Frau darüber informiert, und das ist, finde ich, keine Verräterei, sondern nur gerecht. Er ist bestimmt nicht mit Jubel von seiner Frau begrüßt worden, als er wieder in den Niederlanden ankam.
Briefe schreiben war schon ein paar Monate nicht mehr drin. Es waren nur Postkarten erlaubt, und davon habe ich dann Dutzende an meine Eltern geschrieben. Briefe auf den Inhalt zu kontrollieren, war nämlich viel mehr Arbeit, als bei offenen Postkarten. Zusammengenommen habe ich ungefähr zweihundert Briefe und fünfzig Karten geschrieben. Meine Mutter bewahrte sie alle in einem Ordner auf. Ein halbes Jahr nach dem Krieg bat ich sie darum, aber sie hatte sie alle verbrannt. Wirklich schade, denn ich hätte ein Buch darüber schreiben können.
Dennoch gab es stets mehr Gerüchte, dass wir bald auf Transport nach Hause gehen sollten. Am 8. Mai 1945 wurde Deutschland gezwungen zu kapitulieren; da war in diesem Teil Europas endlich Friede. Trotzdem habe ich noch bis Ende Juni auf meine Repatriierung nach den Niederlanden warten müssen. Hinterher weiß ich, wie das kam, aber wir alle verlangten nach dem Zuhause. Eines Sonntagabends hörten wir, dass am folgenden Morgen ein Transport stattfinden sollte. Ich habe in jener Nacht nur wenig geschlafen, und war dabei nicht der Einzige. Als es am nächsten Morgen so weit war, hörten wir, dass nur Verheiratete nach Haus durften, der Rest musste warten. Eine Enttäuschung zwar, aber auch eine verständliche Maßnahme.
Eine Woche später war der Rest an der Reihe. Morgens um halb Sieben kletterte ich mit einem kleinen Koffer mit der Kleidung, die ich noch übrig hatte, auf einen offenen Armeewagen der Amerikaner, an dessen Steuer ein Neger saß. Ich habe bestimmt keine Abneigung gegen Neger, jeder Mensch mit welcher Farbe auch immer ist mir gleichermaßen lieb, aber diesen Mann mochte ich nicht. Er achtete überhaupt nicht auf die Ladung. Wir wurden auf dem offenen Ding hin- und hergeworfen und er fuhr eine ganze Weile mit Spitzengeschwindigkeit. Es war herrlich warmes Wetter und es hatte seit Tagen nicht geregnet, so dass alles angenehm trocken war. An allem flog er vorbei und fuhr konstant auf der linken Fahrbahn. Eine Pinkelpause und wieder weiter in westliche Richtung. Als wir in einem Grenzort bei der niederländischen Grenze waren, fühlten wir uns zerschlagen und schmutzig. Man konnte nur noch mit einem Pferdekamm durch unsere Haare kommen. Glücklicherweise war dort in dem Auffanglager, also wieder ein Lager, die Sache gut geregelt. Wir mussten schon sehr schnell duschen, und die Kleidung, die wir trugen, wurde chemisch gereinigt. Vor dem Duschraum stand ein Kerl mit einem Eimer weicher Seife. Ein Klacks auf den Kopf, einer auf den Rücken und auf die Brust und dann Duschen - Jungs unter sich. Inzwischen wurde das Gepäck daraufhin kontrolliert, ob man nicht zuviel mitnahm. Einer von den Jungs hatte zwölf Paar nagelneue Schuh in seinem Koffer, natürlich abgestaubt. Zwei Paar durfte er sich aussuchen, der Rest wurde ohne weitere Maßnahmen beschlagnahmt. Nach dem gemeinschaftlichen Duschen musste man splitterfasernackt an zwei Ärzten vorbei, die einem nur unter die Arme guckten und einen anpfiffen, ob man vielleicht die eine oder andere Geschlechtskrankheit habe. Die Elitetruppen von unserem Adolf hatten allesamt eine Stammbuchnummer unter den Armen tätowiert, und danach suchten sie. In der Tat wurden ein paar dazwischen herausgepflückt. Die wollten auf diese Art einfach über die Grenze, aber das ging glücklicherweise nicht.
In einer der Baracken, an denen das Lager reich war, mussten wir die Nacht verbringen. Ein leeres Zimmer ohne Strohsackdecken oder irgendetwas anderes. So behandelt man nicht mal einen Hund. Wir waren wieder zu Hause. Zum Glück dauerte die Nacht nicht lange. Am nächsten Tag wurden wir schon sehr früh mit einer Fahrkarte in der Tasche zu einem Bahnhof gebracht und in den Zug gesetzt. Hier und da hielt der Zug und es stiegen ein paar Jungs aus. Ich saß mit drei Alkmaarern in einem Abteil und wir waren plötzlich sehr still und gespannt, was wir zu Hause antreffen würden. Wie man sah, war alles noch ganz in Ordnung, im Vergleich mit den Trümmerhaufen in Deutschland, die wir unterwegs gesehen hatten.
Weiter als Alkmaar fuhr der Zug nicht. Für den Transport zum nördlichsten Punkt von Noord-Holland waren wir auf ein Fuhrunternehmen angewiesen, das die kleinsten Dörfer anfuhr. Endlich fuhren wir in Den Helder ein und wurden in der Keizerstraat abgesetzt. In dem Moment, als ich aus dem Lastwagen kletterte, fuhr Cor K. vorbei, der ein Blumengeschäft gegenüber des Ladens meiner Eltern hatte. Er sah mich überrascht an: „ Ach Gottchen, Cor, Du lebst noch. Dein Vater und Deine Mutter haben schon drei Monate lang nichts von Dir gehört“. Er versprach mir, sie auf meine Ankunft vorzubereiten.
Es mussten noch einige Formalitäten erfüllt werden, und nach einer viertel Stunde lief ich durch die Keizerstraat zur Sluisdijkstraat, wo wir damals wohnten. In meiner Tasche hatte ich einen Wohnberechtigungsschein und Kleidermarken. Fünfzig Meter bevor ich zu Hause war, ging die Ladentür des Bilderrahmengeschäfte auf und mein Vater kam heraus.
„Mutter, Cor ist wieder da. Da kommt er!“, hörte ich ihn meiner Mutter zurufen, die im Innern stehen geblieben war. Ich ließ meinen Koffer auf die Strasse fallen und rannte zu meinem Vater. Die Arme um die Schultern gelegt betraten wir eine Minute später den Laden. Mein Bruder war auch da, wir haben uns alle umarmt und haben zu viert geheult und gelacht zugleich. Der anrührendste Augenblick in meinem Leben. Der verloren gewähnte Sohn war wieder zu Hause, denn wegen des Ausbleibens von Post aus Deutschland dachte meine Mutter, das dort etwas geschehen sei.
Mein kleiner Koffer lag noch immer auf dem Gehweg, und den holte ich erst mal nach der Heulerei. Der Inhalt war nichts sehr Besonderes und der Koffer selbst war durch das Hin- und Herschieben unter die hölzernen Miefkisten [gemeint sind Betten – C.T.] völlig verschrammt, also reif für den Sperrmüll. Ich fühlte mich aufs Neue wie im Paradies gelandet, nach den paar Monaten Jugendherberge. Ich konnte jetzt auf Socken laufen, denn der Teppich fühlte sich weich an unter den Füßen. Die erste Nacht wieder zu Hause, in meinem eigenen Zimmer und meinem eigenen Bett; ich konnte gar nicht genug davon bekommen.
Am nächsten Tag bin ich mit meinem Vater zum Rathaus gegangen, um mich beim Einwohnermeldeamt zu melden. Mein Vater und meine Mutter bekamen dann auch sofort eine Wohnungsgenehmigung, denn sie wohnten eigentlich immer noch illegal. Wie schnell so eine Neuigkeit wie meine Heimkehr die Runde machte, zeigte sich jetzt auch wieder. Am Tag nach meiner Heimkehr meldete sich mein alter Arbeitgeber bei meinen Eltern zu Hause und fragte, wann ich wieder zu ihm zur Arbeit käme. Ich hatte allerdings das Bedürfnis nach ein paar Wochen Ferien, und das konnte [er] gut verstehen. In der gleichen Woche rief die Mutter meines Freundes Piet A. mich an und erzählte, dass man bei den Wasser- und Elektrizitätswerken einen Hilfsmessgeräteeicher suchte. Ihr Nachbar war Chef der Eichkammer. Wenn ich daran Interesse hätte, sollte ich Kontakt mit ihm aufnehmen. Natürlich hatte ich daran Interesse. Eine Tätigkeit bei der Verwaltung, als Beamter also, war ein Beruf mit großen Sicherheiten, vor allem in jener Zeit. Ich traf eine Verabredung mit dem Herrn van B. und meldete mich einige Tage später bei ihm zu Haus.
„Der Herr van B.“, sagte er immer, wenn er ein Telefonat annahm, war schon ein netter Mann, aber er stand meilenweit über seinem Personal – insgesamt sieben Mann. Damals schaute ich zu ihm auf, jetzt lache ich darüber. Später hatte ich selbst die Verantwortung für vierzehn Mann, verteilt über drei Niederlassungen, und das war schon etwas anderes.
Während des Bewerbungsgespräches kam natürlich mein unfreiwilliger Verbleib von zwei Jahren in Deutschland zur Sprache. Als er danach fragte, zog er die Augenbrauen hoch. Meine Erklärung, dass ich nicht freiwillig gegangen sei, sondern dass ich über den Arbeitseinsatz verpflichtet worden war, nach Deutschland arbeiten zu gehen, und zwar als Zwangsarbeiter, ließ seine Augenbrauen etwas tiefer sacken, aber es blieb trotzdem noch etwas davon zurück. Nachdem wir ausführlich darüber gesprochen hatten, wobei er natürlich das erste Wort führte, logisch, denn er war „Der Chef“, und er erzählte, was für gute Dinge er in den Kriegsjahren getan hatte, erachtete er mich doch für würdig, bei den kommunalen Wasser- und Elektrizitätswerken arbeiten zu dürfen. Er hatte im Krieg ein paar Mal Personalausweise gefälscht und das waren dann seine Heldentaten, die er präsentierte, als ob die Niederlande ihre Befreiung ihm zu verdanken hätten. Vielen Dank, Herr van B.
Ich wurde also Beamter. Meine Eltern waren, wenn das möglich ist, noch froher als ich. Meine Schäfchen waren im Trockenen, so hieß das damals. Van der S. [sein Vorkriegschef – C.T.], der um Informationen über mich von van B. gebeten worden ist, war weniger froh, aber er konnte mir nichts anhaben. Zehn Tage später begann meine Beamtenlaufbahn, und ich habe es nie bereut.
Die Zeit danach
Der Rückblick auf die zwei Jahre hat mich dazu bewogen, davon das eine oder andere aufzuschreiben, sofern es noch in meiner Erinnerung ist. Je mehr man sich dann darein vertieft, desto mehr kommt an Erinnerungen hoch. Verrückt, dass man sich an noch soviel erinnern kann – von diesen verlorenen Jahren. Ein Beweis dafür, wie großen Eindruck die Jahre auf einen gemacht haben.
Wenn ich meine Schreibarbeit dann wieder einmal durchlese, komme ich zu der Entdeckung, dass ich doch noch ein paar Dinge zu erwähnen vergessen habe. Zum Beispiel, die Ankündigung, dass es eine Band in Göttingen gab, die aus Niederländern bestand und die für einen Abend irgendwo in Göttingen für die Zwangsarbeiter auftrat. Wie die Band dahin kam und auf wessen Initiative, habe ich nie erfahren. Da war ein Junge dabei, den ich kannte, er hieß Tom M.
Einmal haben wir sogar ein Päckchen vom Roten Kreuz bekommen. An den Inhalt kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
Nach der Affäre mit all den Jungs von Zimmer Eins dachte ich gar nicht mehr daran, mich auf das W.C. zu setzen, da ich vor der einen oder anderen Ansteckung Angst hatte. Ich war nicht der einzige, der das tat, aber schon der einzige, der darauf angesprochen wurde. Sie nannten mich den „Schwebescheisser“, aber das machte mir nichts aus. Wenn ich deswegen Schwierigkeiten bekam, standen meine Zimmergenossen hinter mir.
Allerdings muss man irgendwann damit aufhören, zu versuchen, all die Erinnerungen wieder hervorzuholen, da man sonst an kein Ende mehr kommt.
Ein paar Tage nach meiner Heimkehr habe ich natürlich Willie G. aufgesucht. Wir sind dreimal miteinander aus gewesen und haben dann sehr viel miteinander gesprochen. Als Freunde haben wir voneinander Abschied genommen. Willie war sehr gläubig und ich nicht. Ich betrachtete mich selbst als Humanisten und versuchte, danach auch zu leben. Vielleicht habe ich diese Erkenntnis durch meinen Umgang in Göttingen mit soviel Menschen aus fremden Ländern gewonnen. Ein Humanist außerkirchlich, aber das heißt in meinem Fall sicher nicht, dass ich anti-gläubig bin. Ein Jeder, der nach seinem Glauben lebt, egal was für ein Glaube das ist, verdient meinen Respekt. Willies und meine Auffassung stimmten nicht miteinander überein. Wie gesagt, wir gingen als Freunde, sofern wir das durch das Briefeschreiben geworden waren, auseinander. Ich habe ihr natürlich für die Briefe, die sie mir schrieb, gedankt. Sie waren mir ja doch eine Stütze.
In den ersten Monaten nach meiner Heimkehr und auch noch Jahre danach, wenn auch in geringerem Maße, habe ich mich gefragt, ob man es mir wohl übel genommen hat, dass ich in Deutschland gearbeitet hatte. Wenn man die Leute hört, die nicht dort gewesen sind, dann waren sie fast alle untergetaucht oder waren im Widerstand und haben Untergrundarbeit geleistet.
Ich gebe sofort zu, dass es viele Untergrundarbeiter gegeben hat, denen viele sehr viel zu verdanken haben. Aber dass es plötzlich so viele Untergrundarbeiter waren, wie nach dem Krieg behauptet wurde, glaube ich nicht. Oder erzählten sie das gerade mir, da ich mit noch weiteren 500.000 Niederländern als Zwangsarbeiter, also nicht freiwillig, in Deutschland gearbeitet habe?
Ich gebe sofort zu, dass es viele Untergrundarbeiter gegeben hat, denen viele sehr viel zu verdanken haben. Aber dass es plötzlich so viele Untergrundarbeiter waren, wie nach dem Krieg behauptet wurde, glaube ich nicht. Oder erzählten sie das gerade mir, da ich mit noch weiteren 500.000 Niederländern als Zwangsarbeiter, also nicht freiwillig, in Deutschland gearbeitet habe?
Wenn man sie dann fragte, was sie dann alles wohl getan hätten, wurden sie sehr vage in ihren Antworten und es erwies sich letztendlich, dass es nicht viel gewesen war. Wollten sie vielleicht mit diesen Indianergeschichten gerade mir gegenüber ihre Vaterlandsliebe beweisen? Du hättest doch auch untertauchen können, wurde mir schon mal vorgeworfen. Diese Möglichkeit wurde mir angeboten, ja, aber die Frau, die mir diesen Vorschlag machte, hatte selbst zwei Söhne, die in Deutschland arbeiteten, da bei Arbeitsverweigerung damit gedroht wurde, den Vater oder die Mutter festzunehmen. Das Risiko war mir viel zu hoch, darum bin ich gegangen. Niemand konnte mir garantieren, dass die Moffen das nicht getan hätten. Meine Eltern waren damals um die fünfzig und hätten eine Festnahme nie überlebt, davon bin ich überzeugt.
Es gab Leute, die aus den großen Städten geflüchtet waren und irgendwo bei einem Bauern Obdach gefunden hatten. Sie nannten sich selbst Untergetauchte. Auf dem Land arbeiteten sie dann bei dem Bauern, und niemand wusste, wer sie waren. Da hatten sie ein viel kleineres Risiko. Vielleicht auch, weil die Einwohnermeldeämter nicht so gut mitarbeiten wollten, wie das unter anderem von dem Amt in Den Helder, das die Deutschen vollständig über die Jungs der Geburtsjahrgänge '22 - '23 informiert hatte, getan worden war. Wie viele der zu Hause Gebliebenen waren wirklich Saboteure?
Ich habe in Deutschland feine Menschen getroffen, auch Deutsche. Ich hatte mit ihnen ein gutes Einvernehmen; obwohl es Deutsche waren, waren es doch Menschen. Ich habe an Herrn Bart und an Heinrich Siebert nur gute Erinnerungen. Frau Melchior werde ich niemals vergessen, sie war wie eine zweite Mutter zu mir und zu Johan. Es gab wenige Nationalsozialisten, obwohl es schon so hingestellt wurde, als ob jeder Parteimitglied war. Die meisten verabscheuten den Krieg und die Methoden von Hitler und seinen Gefolgsleuten. Aber sie hatten Angst, und muss man sich dafür schämen? Ist das Schwäche oder ein erlaubter Versuch der Selbsterhaltung, um die Familie zu retten? Ich wurde niemals von einem Deutschen, mit dem ich zusammenarbeiten musste, ungerecht behandelt. Einfach weil sie sich in ihrem Herzen schuldig an der Tatsache fühlten, dass ich da arbeiten musste und sie nichts daran ändern konnten. Ich wurde ebenfalls niemals politisch beeinflusst. Mit mir wurde nie über den Nationalsozialismus gesprochen. Gezwungenermaßen, aus Selbsterhaltung, wurde dies peinlich vermieden. Man konnte ja in diesen Jahren und speziell in diesem Deutschland niemandem vertrauen.
Deutsche waren sie alle, daran ist nichts Ungewöhnliches. Wir selbst waren in Deutschland mehr Niederländer als in unserem wasserreichen Ländchen. In Zeiten der Not wächst ja auch auf einmal die Vaterlandsliebe. Frau Melchior war eine echte Deutsche, aber bestimmt keine NS-Anhängerin. Vor allem nach dem Besuch ihrer Tochter mit dem Arzt sprach sie ihren Abscheu über das Verhalten einiger ihrer Landsleute aus, und sie hatte danach noch mehr Mitleid mit uns als davor. Ich gebe sofort zu, dass ich mit meiner Zeit in Deutschland enorm viel Glück gehabt habe. Wenn ich mich damals in Hannover nicht auf das W.C. gesetzt hätte, wäre es sicher ganz anders gelaufen.
Ob wir etwas aus den Kriegsjahren gelernt haben? Ja, natürlich, die Niederländer fühlten sich eins. Zu welchem Glauben man sich auch bekannte, ob man arm war oder reich, wir waren Niederländer und vom Feind besetzt. In Zeiten der Not wissen wir einander zu finden, vor allem wenn Krieg ist, denn das ist das Schlimmste, das einem Menschen passieren kann. Alle Nicht-Deutschen in Deutschland bildeten eine große Gruppe. Ich war wirklich mit ein paar Russen befreundet, sogar mit zwei Türken bei mir in der Halle. Wenn es darauf ankam, bildeten wir Niederländer in Göttingen auch eine Gruppe, aber als die Rettung da war, war die Devise wieder: „Ich, ich, ich und der Rest kann draufgehen“. Manchmal frage ich mich, ob das ein typisch niederländischer oder einfach ein allgemein menschlicher Zug ist. Also zeigte es sich wieder, dass wir nicht so viel daraus gelernt hatten, wie wir eigentlich hätten tun sollen.
Ich habe hier erzählt, dass ein paar von uns Jungs manchmal zur Kirche gingen. Welche Kirche das war, weiß ich nicht und finde das auch nicht so wichtig. Eine Kirche ist in meinen Augen eine Kirche, in der das Wort Gottes verkündigt wird und wo man lernt, wie man als Christ mit dem Mitmenschen umgehen sollte. Einmal bin ich mit einem Jungen zu einem Gottesdienst mitgegangen. Eine Predigt und dann noch auf Deutsch, kam mir an dem Sonntagmorgen so unwirklich vor. Das, was der Prediger sagte, stimmte doch auch nicht. Warum war ich in Deutschland? Für mein Gefühl war es so, als ob der Mann, der auf der Kanzel stand, fluchte. Ich bin da nie wieder hingegangen.
Noch immer gibt es überall auf der Welt Krieg. Es vergeht keine Minute und irgendwo wird ein Schuss gelöst. Man wir über die Medien täglich damit konfrontiert, und es klingt fast gefühllos, aber man muss damit zu leben lernen, da wir dem so ohnmächtig gegenüberstehen.
1986 sind vier bis fünf Millionen Menschen durch Kriegshandlungen ums Leben gekommen. Über Bewaffnung wird gesprochen, als ob es um die Taktik von einem Fußballturnier geht. Sogar die Wettkampfregeln sind festgelegt: Gift ist verboten. Chemische Waffen zu benutzen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Mensch hat Rechte, wird dann mit ernstem Gesicht gesagt, und jeder findet, dass das schön gesagt ist. Als über die Vernichtung von derartigen Waffen gesprochen wurde, zeigte es sich, dass es einen Vorrat von zwanzig bis vierzig Millionen Tonnen an derartigen Waffen gab. Mehr als genug, um die ganze Weltbevölkerung auf einen Schlag auszurotten. Beschuss mit Kanonen gehört zu den normalen Kriegshandlungen. Dann fragt man sich, was wir alle so treiben.
Am siebten Mai 1945 um zwanzig vor drei kapitulierte Deutschland, und in der Nacht vom achten Mai trat in einem großen Teil Europas eine Stille ein. Eine Stille, die in dem Teil Europas mehr als fünf Jahre lang nicht mehr gehört worden war. Denn Stille kann man auch hören.
Ab siebten Mai 1945 begann sich die Waffenindustrie allerdings wieder auf vollen Touren zu drehen. Es war ja eine neue Gefahr entdeckt worden, oder müssen wir sagen, erfunden worden, die Sowjetunion. Notabene die, der wir unsere Freiheit mit zu verdanken hatten. Es scheint, als ob wir nicht ohne Feinde auskommen können.
Wernher von Braun, der Konstrukteur und Erfinder der berüchtigten V1 und V2 Waffen aus dem fünften Kriegsjahr, wurde sofort 1945 nach Amerika geholt, bevor die Russen ihn einsammeln konnten. Um als Kriegsverbrecher abgeurteilt zu werden? Oh nein! Dieser Mann war von unschätzbarem Wert. Er war ja in Amerika viel zu gut zu gebrauchen.
Noch immer tun wir unser Bestes, um immer bessere Waffen zu erfinden. Je größer die Vernichtungskraft ist, desto besser. Milliarden werden täglich für Bewaffnung ausgegeben.
1986 haben die Vereinigten Staaten 219 Milliarden Dollar, England 30 Milliarden, für Rüstung ausgegeben; Frankreich steht auf dem dritten Platz. Unser Land stand in dem Jahr mit fast zwölf Milliarden Gulden auf dem elften Platz. Darin kann ein kleines Land groß sein. Von Russland wissen wir nicht viel, aber das wird sich kaum von den Vereinigten Staaten unterscheiden.
Auch unser Land macht da also mit, wenn auch in kleinerem Maßstab als die industrialisierteren Länder. Aber auch in unserem Land wird die Kriegsindustrie in Stand gehalten, weil sie die Arbeitslosigkeit bekämpft. Auch hier spricht man über das Arbeitspensum, die Kosten kommen an zweiter Stelle. Denkt nur an die U-Boote zu 700 Millionen pro Stück. So etwas kostet das, aber was machen da schon hundert Millionen mehr oder weniger. 1989 wurden 1000 Millionen Dollar für Rüstung ausgegeben.
Als Hitler 1933 an die Macht kam, zumindest die ersten Schritte dazu machte, wurde die Kriegsindustrie enorm erweitert. Autobahnen, die wir, wenn wir heute in den Urlaub fahren, benutzen, wurden angelegt, und die Arbeitslosigkeit wurde mit einem Schlag beseitigt. Auf Kosten zwar von vielen anderen Dingen, aber das realisierte man erst, als es schon zu spät war.
Wenn ich einen deutschen Soldaten ansah, oft noch ein Kind und jünger als ich damals war, der in seinem Rollstuhl über einen Fußweg in Göttingen fuhr, sah ich nur „einen Soldaten“, wie es sie viele in der ganzen Welt gibt. Dann dachte ich fast immer, wieder ein Mensch, dessen Leben verwüstet ist. Und hatte er darum gebeten? Nein, natürlich nicht, er musste. Und das war jetzt Gottes Wille. Ich konnte das nicht glauben, damals bestimmt nicht.
Am 26. Juni 1945 wurden die ersten Schritte zur Errichtung der Vereinten Nationen gemacht. Der erste Generalsekretär war Trygve Lie, dem später Dag Hammerskjold folgte, dann U Thant und 1972 Kurt Waldheim, der später sehr umstrittene Präsident Österreichs. Vor allem die ersten beiden, Lie und Hammerskjold, wirkten wie Friedensengel, die Europa vor einem Dritten Weltkrieg behüten sollten. Der Schwede Hammerskjold empfing 1961 den Friedensnobelpreis. Sein Tod in Folge eines Flugzeugunglücks wirkte auf viele, auf mich ganz besonders, wie eine Katastrophe.
Obwohl sich ihre Ohnmacht manchmal deutlich zeigt, bietet diese Organisation doch ein großes Maß an Sicherheit, dass der Menschheit eine Katastrophe wie der Zweite Weltkrieg erspart bleiben kann. Allerdings machen Länder wie die Vereinigten Staaten und Russland viel zu oft Gebrauch von ihrem Vetorecht, was für ein „Recht“ das denn auch sein mag, und dadurch werden, in meinen Augen, positive Beschlüsse in Grund und Boden gerammt.
1987 sind endlich Verhandlungen begonnen worden, um all die Hunderte Raketen, basierend auf dem Prinzip der Wernher von Braun Rakete, zu vernichten. Vielleicht ist dies dann doch der Anfang einer wirklichen Abrüstung. Es scheint so seltsam, so unwirklich, aber es ist, als ob wir nicht mehr ohne Bewaffnung auskommen können.
Neunzehnhundertneunundachtzig war ein Jahr, das mit Großbuchstaben in den Geschichtsbüchern erwähnt werden muss. Die große Umkehr im kommunistischen Osteuropa, besonders in Russland, und alles unter der Leitung von Gorbatschow, einem Mann, der mehr als alle anderen, Recht auf einen Friedensnobelpreis hätte. Sollten wir das Paradies doch noch etwas näher zu uns heran holen können? Oder ist nur der Beginn der Menschheit für eine kurze Zeit ein echtes Paradies gewesen, das niemals wieder zurückkommt?
Lasst uns alle unser Bestes dafür tun, dass uns eine neue Katastrophe erspart bleibt, denn sonst würde sich herausstellen, dass wir aus dem, was wir von 1940 – 1945 erlebt haben, nichts gelernt haben.
Ich habe dies Buch „Verlorene Jahre“ genannt, weil ich mich ihrer als solche erinnere. Jeder Tag, an dem ein Krieg geführt wird, ist ein verlorener Tag. Eigentlich verwunderlich, dass bei mir, jetzt da ich das Buch schreibe, auf einmal so viele Erinnerungen auftauchen. Darin zeigt sich, was für einen tiefen Eindruck diese Jahre bei mir hinterlassen haben, und nicht nur bei mir. Viele haben jetzt noch Nachwehen von den paar Jahren in Deutschland.
Die Vereinigung der Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg wurde 1988 gegründet, und jetzt zeigt sich, wie viele Menschen noch immer geistige Mühe haben, das, was sie damals erlebt haben, zu verarbeiten. Glücklicherweise hat meine Mitgliedschaft in der Vereinigung mich davon überzeugt, dass ich nicht fout [wörtl. falsch; in den NL unterscheidet man gut und falsch in Bezug auf die Okkupation, gut = Widerstand usw., fout = NSB, Kollaborateur usw. - HEW] gewesen bin. Jetzt zeigt es sich, wie die damaligen Behörden, und das waren keine Anhänger des Nationalsozialismus, uns Jungs den Deutschen auf einem Präsentierteller geliefert haben. Viele Daten über die Zeit, was damals alles auf den Arbeitsämtern geschehen ist, sind verschwunden, einfach verbrannt.
Die Vereinigung tut sehr viel für uns, alle Mitglieder waren damals Zwangsarbeiter, Freiwillige werden natürlich in unserer Vereinigung nicht zugelassen, und immer mehr kommt uns zu Bewusstsein, dass wir uns nicht schuldig fühlen müssen. Aber dass das mehr als vierzig Jahre dauern musste, ist ein Jammer. Es hätte viel Leid erspart werden können – und das ist keine übertriebene Behauptung. Viele Jungs haben die Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht haben, niemals vergessen können und wurden auf die Dauer zu geistigen Wracks. Es gibt Leute, die, wenn über die Zeit gesprochen wird, sprachlos sind und darüber nicht mehr sprechen wollen. Einfach nur, weil sie diese Zeit, für die sie sich noch immer schuldig fühlen, nicht vergessen können. Wenn man die Erzählungen von einigen Untergetauchten hört, ist es, als ob das eine schöne Zeit war, so begeistert, wie sie darüber erzählen können. Für keinen Menschen war es eine schöne Zeit, auch nicht für die Soldaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand auf die Medaillen auf seiner Brust, für bewiesenen Mut und andere Heldentaten, stolz sein kann. Wenn man in Zeiten des Krieges einen Gegner tötete, bekam man vielleicht einen Orden. Je mehr Tote, desto größer die Auszeichnung. Wenn man in Friedenszeiten jemanden tötet, bekommt man sechs Jahre Gefängnis. Ich sehe den Unterschied nicht.
Ich höre mit dem Schreiben auf. Meine Absicht war die Hoffnung, dies jetzt von mir wegschreiben zu können, und ich fühle, dass mir das gelungen ist. Aus diesen Gründen ist das Buch ein Erfolg. Wie ein anderer darüber denkt, muss der andere dann selbst wissen.
Am 22.9.2001 schrieb Cornelis J. K. einen ergänzenden Brief zu seinem Erinnerungsbuch.
|